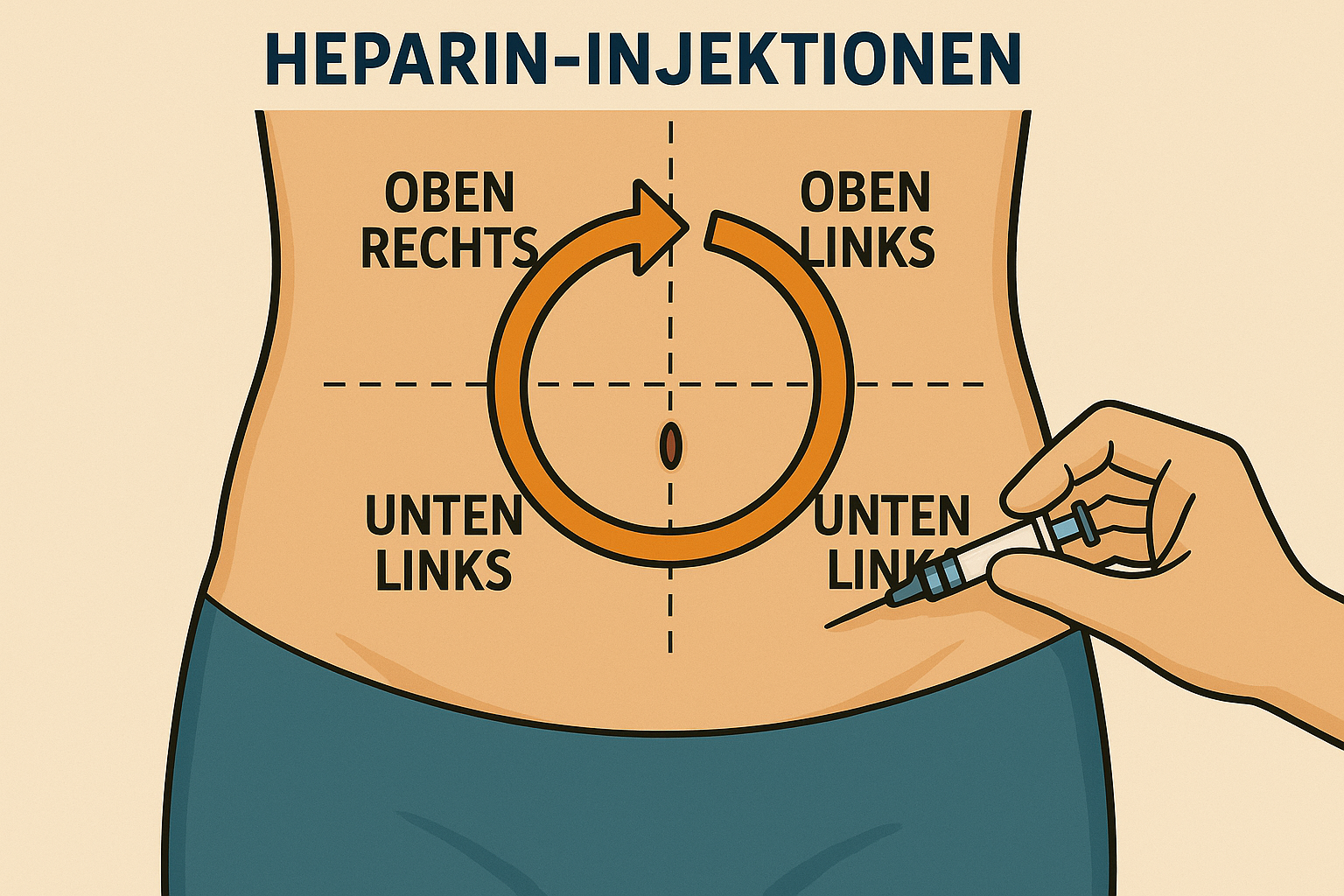Trinken bei sportlicher Belastung
Ein Beitrag von Frank Behnke – Heilpraktiker · Physiotherapie · Sportphysiotherapie
Einleitung
Die Bedeutung einer gezielten Flüssigkeitszufuhr bei sportlicher Belastung ist unbestritten – doch die Umsetzung ist oft fehlerhaft:
Viele trinken zu viel, zu wenig oder das Falsche – und gefährden damit Leistung, Regeneration und im Extremfall sogar ihre Gesundheit.
Diese Abhandlung klärt praxisnah, was bei länger andauernden Belastungen – insbesondere bei Hitze – physiologisch passiert, und welche Trinkstrategie wirklich sinnvoll ist.
Physiologischer Hintergrund
Beim Sport verliert der Körper über Schweiß nicht nur Wasser, sondern auch wichtige Elektrolyte wie:
•Natrium (Na⁺)
•Chlorid (Cl⁻)
•Kalium (K⁺)
•Magnesium (Mg²⁺)
•Spuren von Zink und Kalzium
Ein Verlust von mehr als 2 % des Körpergewichts durch Schweiß kann bereits die körperliche Leistungsfähigkeit deutlich mindern, das Herz-Kreislauf-System destabilisieren und die Thermoregulation stören.
(↳ Sawka et al., 2007)
Typische Folgen unzureichender Trinkstrategien:
•gesteigerte Herzfrequenz
•schnellere Erschöpfung
•Kopfschmerzen
•Muskelkrämpfe
•erhöhter Cortisolspiegel
•und bei extremem Fehlertrinken: Hyponatriämie
(↳ Hew-Butler et al., 2015)
Wie viel trinken?
Die Trinkmenge sollte nicht pauschal, sondern individuell angepasst werden.
Allgemeine Empfehlungen lauten:
Belastungsdauer Trinkmenge (bei Hitze)
< 60 Min meist keine Zufuhr nötig, außer bei Hitze
60–120 Min 400–800 ml/h
>120 Min 600–1000 ml/h
Empfohlen wird ein Wiegetest vor und nach dem Training:
Jeder Kilogrammverlust entspricht ca. 1 Liter Schweiß.
Was trinken?
Reines Wasser reicht bei längerer Belastung nicht aus.
Empfohlen werden:
Isotonische oder leicht hypotone Getränke:
•enthalten Natrium (400–700 mg/l)
•ggf. Glukose oder Maltodextrin (6–8 % Kohlenhydratanteil)
•osmotisch angepasst, um Wasseraufnahme im Darm zu beschleunigen
❌ Ungünstig:
•Leitungswasser pur (→ „Verdünnungshyponatriämie“)
•reine Magnesium- oder Multivitamin-Drinks (→ keine akute Wirkung)
•alkoholhaltige Getränke (→ dehydrierend)
(↳ Thomas et al., 2016; Shirreffs, 2005)
Elektrolyte gezielt zuführen
Am wichtigsten ist Natrium, da es Wasser im Extrazellulärraum hält.
Empfehlung:
→ 0,5–0,7 g Natrium pro Liter Trinkflüssigkeit
Ergänzend:
•Kalium (ca. 200 mg/l)
•Magnesium (nur bei Mangel relevant)
•evtl. Elektrolytkapseln bei hoher Schweißrate
Trinkzeitpunkt – nicht zu spät!
Trinken nach Durstgefühl ist bei kürzeren Einheiten sinnvoll.
Aber:
Unter Hitzestress oder intensiver Belastung ist das Durstempfinden verzögert.
Besser:
•300–500 ml ca. 30–60 Minuten vor Belastung
•danach alle 15–20 Minuten kleine Mengen trinken
(↳ Casa et al., 2000)
Praktische Tipps für Training & Wettkampf
Phase Empfehlung
Vorher 300–500 ml, leicht gesalzen oder mit Elektrolytzusatz
Währenddessen alle 15–20 Min. trinken, insgesamt 400–800 ml/h
Nachher Flüssigkeitsverlust ausgleichen: 1,5× Schweißverlust
Sonderfall Hitze ggf. Elektrolyte zusätzlich zuführen (Trinksalze, Kapseln)
Fazit
Gezieltes Trinken ist keine Nebensache – es ist Leistungsfaktor und Gesundheitsgarantie zugleich.
Gerade bei Hitze, langen Einheiten oder hoher Intensität entscheidet das „Wie“ über dein Durchhaltevermögen, deine Regeneration – und ob du deinen Körper schützt oder überforderst.
Trinke mit System – nicht mit Bauchgefühl.
Quellen:
1.Sawka, M.N. et al. (2007): American College of Sports Medicine position stand. Exercise and fluid replacement.
2.Thomas, D.T. et al. (2016): Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Nutrition and Athletic Performance.
3.Casa, D.J. et al. (2000): Preexercise hydration and physiological effects during exercise.
4.Shirreffs, S.M. (2005): The importance of good hydration for work and exercise performance.
5.Hew-Butler, T. et al. (2015): Statement of the 3rd International Exercise-Associated Hyponatremia Consensus Conference.

 Praxis-Check – Häufige Ursachen für Hartspann
Praxis-Check – Häufige Ursachen für Hartspann Abgelaufene Laufschuhe
Abgelaufene Laufschuhe Quellen
Quellen